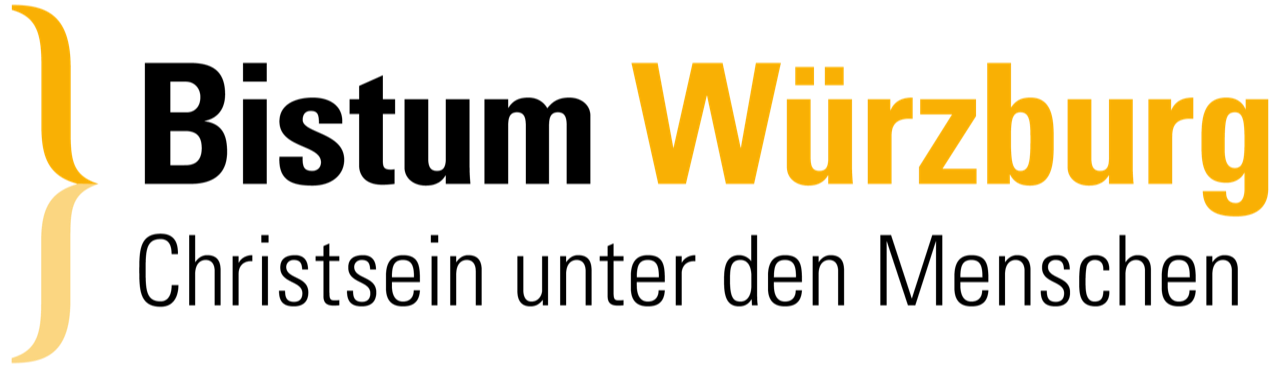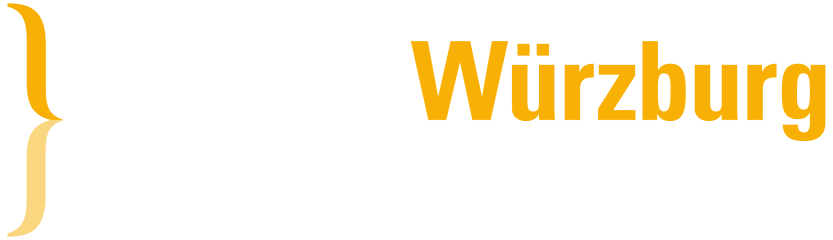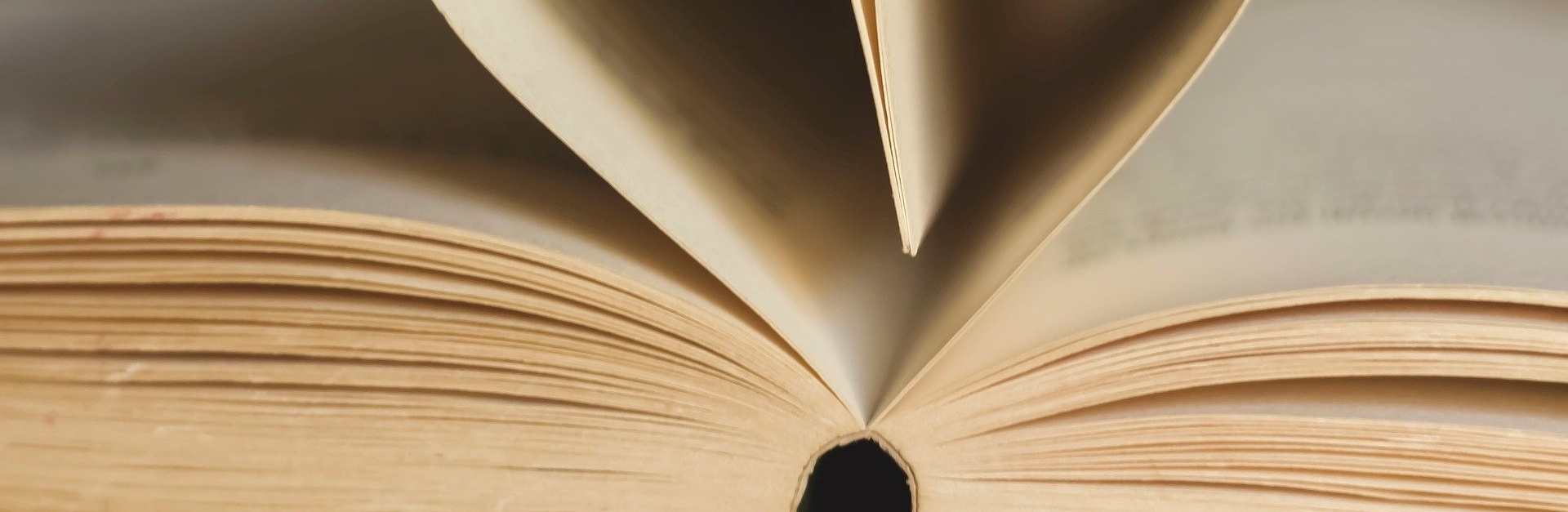Es gibt den guten Brauch, während der Passionszeit die Kreuze zu verhüllen. Neuerdings findet man sogar Kirchen, in denen alle Bilder und Statuen verhängt werden. Dabei geht es um das Fasten der Augen. Der tägliche Anblick bringt ja eine Gewöhnung mit sich, das Bekannte nicht mehr wirklich in den Blick zu nehmen. Erst nach einer Zeit der Enthaltsamkeit der Augen sieht man den Gegenstand wieder. Wie wichtig ist das gerade für uns in der Kirche: Die Kostbarkeit der Figuren und Bilder, die Bildinhalte und Glaubensaussagen dürfen nicht dem Gewöhnungseffekt zum Opfer fallen.
Wie viel mehr gilt dies für den Anblick des Gekreuzigten! Wir machen uns kaum noch klar, was das Karfreitagsgeschehen bedeutet: Er der Ursprung allen Lebens, „Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater“, wie wir im Credo bekennen, hat sich von den eigenen Geschöpfen töten lassen.
Fasse, wer es fassen kann!
Es gibt unzählige Darstellungen des Gekreuzigten: Von dem am Kreuz in königlicher Pose erhöhten Herrn bis zu den mit Pestbeulen zermarterten Christus des späten Mittelalters. Jede Zeit hat neu versucht, ihre Frage nach dem Sinn des Leidens in der Welt mit dem Gekreuzigten zu verbinden. In dem gekreuzigten Christus fällt alles Leiden der Welt wie in einem Focus zusammen.
Erst in der Moderne verselbständigt sich in den vielen Darstellungen wieder das Leid – ohne doch eigentlich von Christus los zu kommen. So verweist selbst noch der berühmte Plötzenseer Totentanz von Alfred Hrdlicka nicht nur durch die Bildwahl des Triptychons auf das Karfreitagsgeschehen. Er ruft in dieser Arbeit die gräulichen Geschehen in der nationalsozialistischen Hinrichtungsstätte Berlin-Plötzensee auf und findet für die Gehängten kein anderes Bildmotiv als das bei dem gekreuzigten Herrn vorgegebene.
Im grauenvollen Sterben Jesu Christi fällt alles Leid der Welt zusammen. Keiner leidet für sich allein, ausgestoßen, verlassen und vergessen. Christus als der Gekreuzigte ist immer mit dabei. Das über die Freude an unserer Erlösung hinaus auch ein Trost des heutigen Tages.
Es gibt eine kleine Tuschezeichnung, die mir eine neue Blickrichtung auf den Gekreuzigten ermöglicht hat. Sie stammt von Johannes vom Kreuz (1542-1591), dem großen Mystiker des Leides. Er hat sie nach einer Vision mit einfachen Strichen angefertigt: Die Blickrichtung geht von oben nach unten. Man schaut auf den Gekreuzigten von oben, gleichsam aus dem Himmel und nimmt zuerst das dornengekrönte Haupt Jesu wahr; darunter die ausgebreiteten Arme und darunter den Rumpf des Körpers. Johannes vom Kreuz wählte gleichsam die Perspektive des Vaters: Der Vater schaut auf seinen Sohn, der Allmächtige auf den scheinbar Ohnmächtigen. Gott schaut auf die sich im Schmerz verschenkende und damit rettende Liebe. Nehmen wir den leisen Anruf wahr?
Amen.
(33 Zeilen/1507/0555; E-Mail voraus)