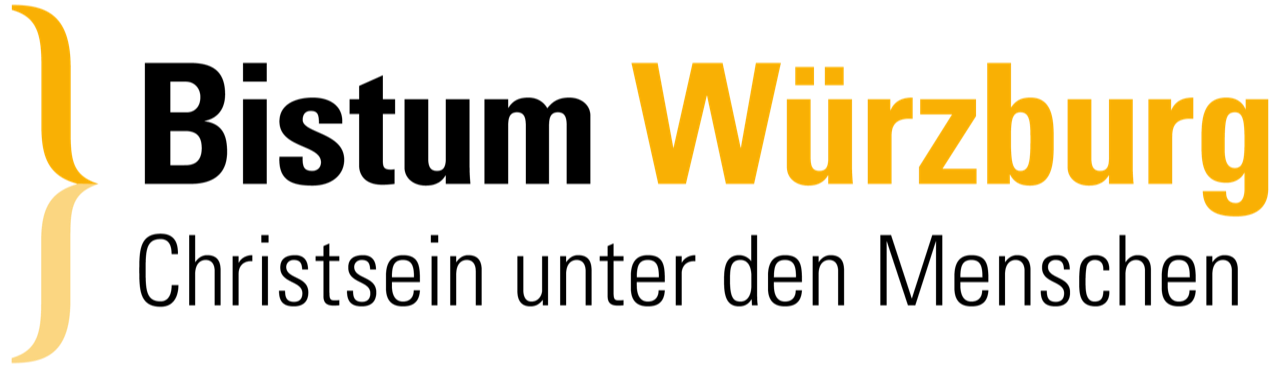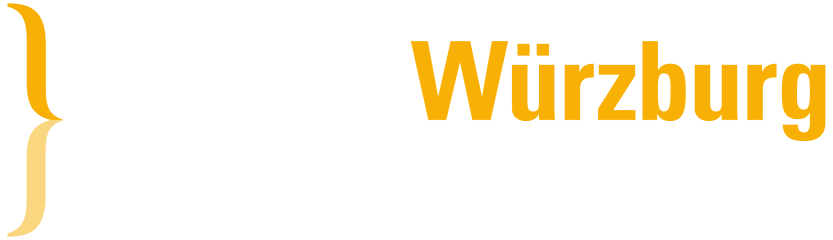© Sonntagsblatt: Christian Ammon
Mit einem Denkmal im Innenhof erinnert die Stiftung Juliusspital seit kurzem an einen Schatten, der schwer auf ihrem Gründungsjahr 1579 lastet. Mit seinem „Julier Spital“ sorgte Fürstbischof Julius Echter nicht nur für einen Meilenstein der sozialen Fürsorge, er schuf auch ein steingewordenes Zeichen der Rekatholisierung des Hochstifts. Als Standort wählte er einen jüdischen Friedhof am Rande des mittelalterlichen Stadtzentrums, ungeachtet des religiösen Ewigkeitskontextes im jüdischen Glauben. Jüdische Friedhöfe sind für die Ewigkeit angelegt und dürfen nicht einfach aufgelöst werden.
Zuvor hatten Echter und seine Amtsvorgänger die Juden aus der Stadt vertrieben, erklärt Walter Herberth, der Leiter der Juliusspital-Stiftung. Noch heute befinden sich unter den Fundamenten des mächtigen Renaissancebaus die Gräber von Würzburger Juden, darunter bedeutende Gelehrte und Rabbiner.
Diese hatten im 13. Jahrhundert mit der Fortschreibung der Halacha, des jüdischen Traditionswissens, der Würzburger Gemeinde zu europaweiter Geltung verholfen. Das Denkmal befindet sich nun etwa in der Mitte des früheren Friedhofs. Die Inschrift, die auf einer Stele, ähnlich einem jüdischen Grabstein, angebracht ist, weist auf diese Tatsache hin: „Ab 1147 jüdischer Friedhof, 1576 bis 1580 Bau des Juliusspitals durch Julius Echter, heute große soziale Stiftung.“
„Grob und rücksichtslos“
Die einst blühende jüdische Gemeinde des 13. Jahrhunderts war damals schon lange untergegangen. Dennoch waren die Juden, die bei Rittern und Adeligen Schutz gesucht hatten, keineswegs bereit, den seit 1147 für Bestattungen genutzten Friedhof widerstandslos dem Fürstbischof zu überlassen. Ihren Einspruch bei Kaiser Rudolf II. 1576 beantwortete Echter mit vollendeten Tatsachen. In der Gründungsurkunde von 1579 findet sich denn auch nur die knappe Bemerkung, dass sich am Ort des Spitals von altersher ein „Judengarten“ befunden habe. Ein Hinweis darauf, dass er noch wenige Jahre vorher für Begräbnisse genutzt wurde, fehlt.
„Das Spital wurde von Julius Echter in einer groben und rücksichtslosen Aktion auf den Gräbern der mittelalterlichen Judengemeinde errichtet“, lautet denn auch das nüchterne Fazit des Würzburger Theologen und Judaisten Prof.
Dr. Karlheinz Müller. Echter kümmerte die Anliegen der Juden wenig. Nach den Verheerungen der Bauernkriege und des Markgräflerkriegs zählte für ihn allein das umfangreiche Gelände in nächster Nähe zur Stadt. Mit dem Spital errichtete er eine entscheidende Säule seines stramm organisierten frühabsolutistischen Fürstenstaats, in dem für Andersgläubige kein Platz mehr war. Ebenso wie die Lutheraner standen die Juden vor der Alternative: Annahme des wahren Glaubens oder Vertreibung aus dem Hochstift.
Gegenreformation
Die Stiftungskirche St. Kilian, die Echter 1580 persönlich geweiht hatte, entwickelte sich zu einem der herausragenden Schauplätze der Gegenreformation. Noch im Jahr der Kirchweihe fand hier die Taufe dreier Juden statt. Müller schließt daraus, dass Echter dem Juliusspital bewusst die Aufgabe zumaß, nicht nur den Körper, sondern auch die Seele zu heilen. Dabei hatten sich die Würzburger Bischöfe traditionell als Schutzherren der Juden betrachtet und die Juden vor den Vorwürfen des Ritualmords, der Hostienschändung oder der Brunnenvergiftung verteidigt. Beim „Rintfleisch-Pogrom“ von 1298 und dem Pogrom von 1349 gerieten die Juden zwischen die Fronten im Konflikt zwischen Bischof und Bürgern.
Der Bau der Marienkapelle, den die Bürgerschaft am Platz der früheren Synagoge selbst veranlasst hatte, war ab 1377 das sichtbare Zeichen für den Untergang der jüdischen Gemeinde. Seither lebten nur noch Einzelpersonen in Würzburg. Für sie fühlten sich die Bischöfe nicht verantwortlich. Seit Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts kam es regelmäßig zu Ausweisungen von Juden aus dem Würzburger Fürstbistum, die die Fürstbischöfe betrieben hatten.
Spektakulärer Fund
Als Bagger 1987 beim Abriss eines früheren Dominikanerinnenklosters in der Vorstadt Pleich auf jüdische Grabsteine stießen, entpuppte sich dies als einer der spektakulärsten Funde der jüdischen Geschichte in Deutschland. Ein großer Teil der 1435 „Judensteine“ stammt offensichtlich von dem mittelalterlichen Judenfriedhof auf dem späteren Gelände des Juliusspitals. Bei Grabungen im Innenhof stießen Archäologen auf die zugehörigen Gräber. Die Gräber sind heute im Museum des jüdischen Gemeinde- und Kulturzentrums „Shalom Europa“ in Würzburg zu sehen.