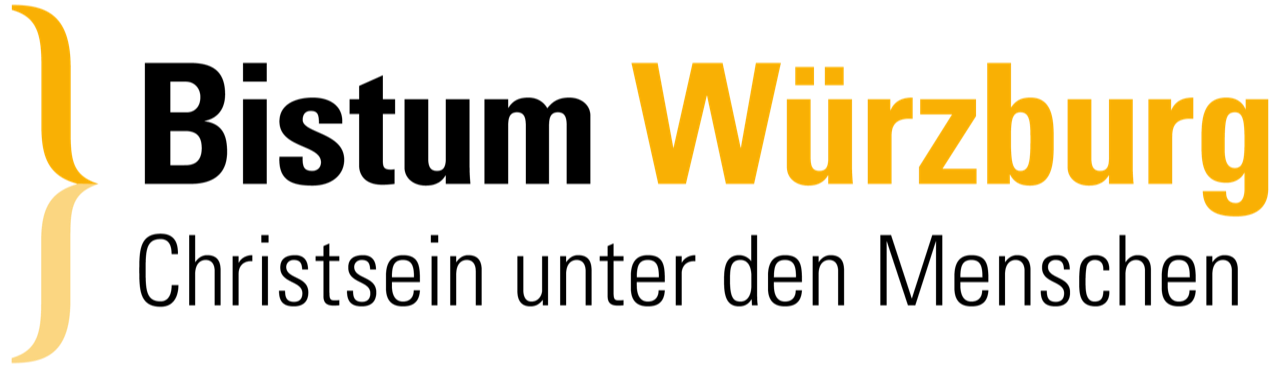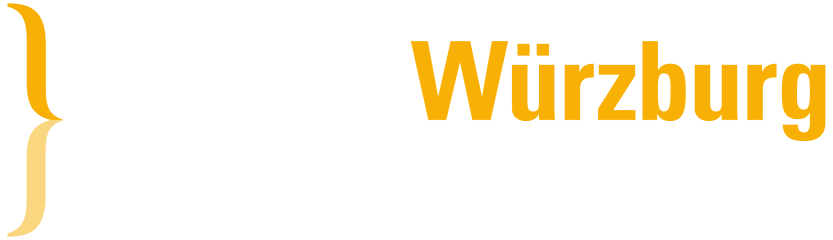Der Holocaust Gedenktag wurde mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Christuskirche und einem wissenschaftlichen Vortrag im Rathaus über "Die vergessenen Verfolgten" der NS-Zeit begangen. Die Kirchen, die Stadt Aschaffenburg sowie der Förderkreis Wolfsthalplatz hatten dazu eingeladen.
In seiner Ansprache in der Christuskirche nahm Pfarrer Hauke Stichauer Bezug auf den Film "Im Labyrinth des Schweigens". Erschütternd genau werde darin von der Verdrängung des Holocaust im Nachkriegsdeutschland erzählt. Durch das beginnende Wirtschaftswunder Ende der 1950-er Jahre gerieten die Ereignisse der NS-Zeit und des Krieges immer mehr in Vergessenheit. Es war dem Mut einiger weniger Juristen zu verdanken, dass, allen Widerständen zum Trotz, Ermittlungen gegen die Täter der Vernichtungslager aufgenommen wurden und 1963 der Auschwitz-Prozess in Frankfurt/Main beginnen konnte. "Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft". Dieses Zitat Wilhelm von Humboldts (+ 1835) habe bis in die neueste Zeit hinein seine Gültigkeit bewahrt, führte Pfarrer Stichauer aus.
Der anschließende Vortrag über "Die vergessenen Verfolgten" der NS-Zeit fand im großen Sitzungssaal des Rathauses statt. Die Referentin, Prof. Dr. Annette Eberle, ist Lehrstuhlinhaberin für Pädagogik in der Sozialen Arbeit an der Katholischen Stiftungshochschule in Benediktbeuern. Sie beteiligte sich unter anderem am Aufbau und in der Leitung der Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte Dachau. Eberle stellte anhand von Briefdokumenten die Auswirkungen der nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik sowie das Zusammenwirken von Fürsorge und Psychiatrie vor. Die Opfer waren entweder durch Erbkrankheiten auf Fürsorge angewiesen, sie waren obdachlos oder suchtkrank, körperlich, psychisch oder geistig behindert. Ihre Unterversorgung in Zwangsanstalten und Konzentrationslagern hatte eine hohe Sterblichkeitsrate zur Folge. Aus dem Inhalt der Briefe von vier Betroffenen wurde deutlich, dass auch die Angehörigen der Opfer von der gesellschaftlichen Ausgrenzung mit betroffen waren.
Wie lange die Schatten des nationalsozialistischen Unrechts währten, zeigt die zögerliche wissenschaftliche und öffentliche Aufarbeitung des Schicksals dieser vergessenen Opfer. Erst in den 1980-er Jahren wurde den Überlebenden ein Anrecht auf geringe Entschädigungsleistungen zugesprochen.
(Text und Fotos: Dr. Gabriele Lautenschläger)