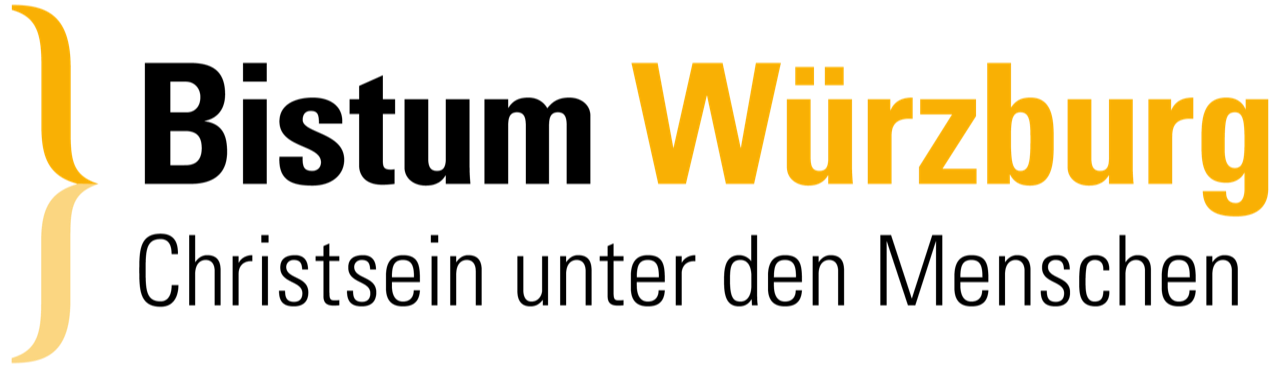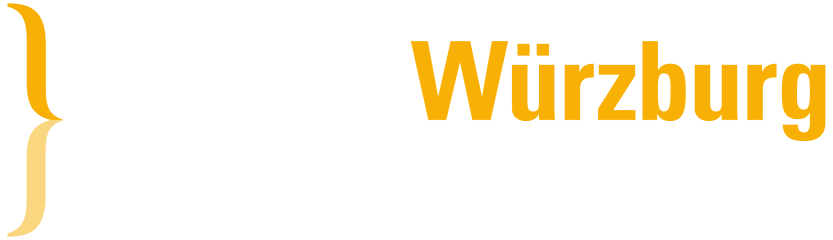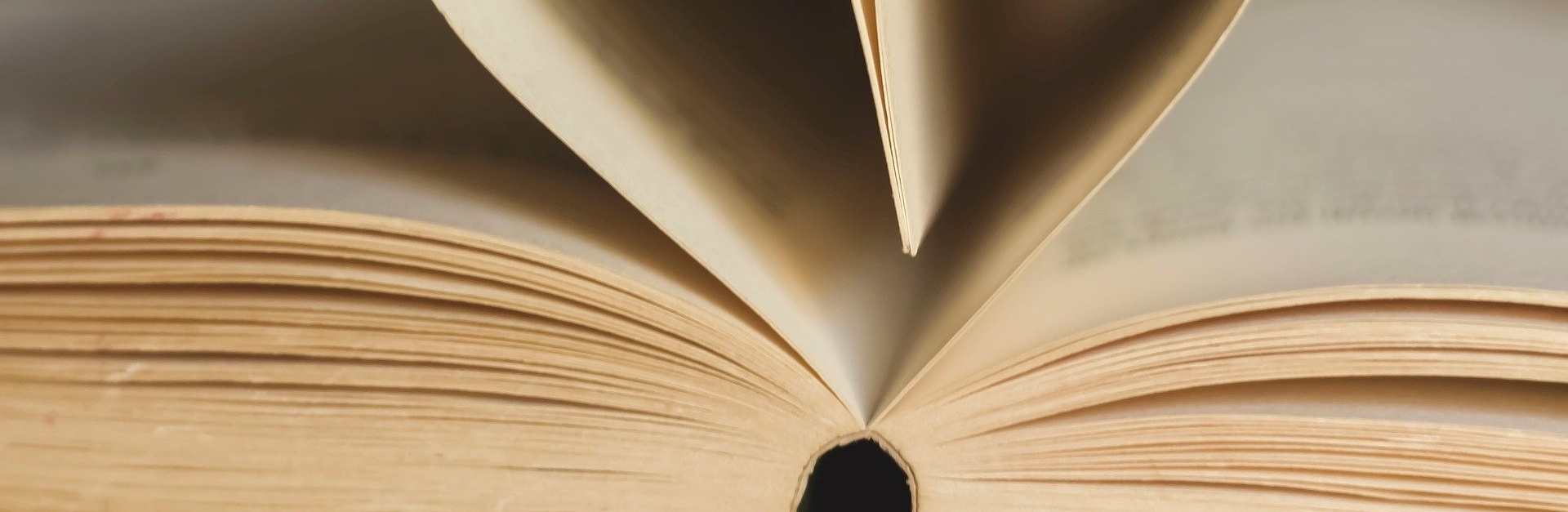„Wenn weder die christliche Weltanschauung des Künstlers als Kriterium ausreicht, noch der Inhalt christlicher Themata ein Werk zur christlichen Kunst macht, genügt es dann einfach, große profanisierte Künstler mit kirchlichen Aufträgen zu betrauen, um ‚christliche Kunst' zu schaffen?“, fragte der Bischof und wies darauf hin, dass es viele vermeintlich christliche Werke zum Beispiel aus dem Barock gebe, die nicht der christlichen Erbauung dienten, sondern durchaus der Augen- und Sinnenlust.
Der Begriff „christliche Kunst“ bedürfe einer theologischen Erschließung. Uneigennützige Hilfeleistung am Nächsten vermöge auch der Nichtgetaufte zu leisten. „Aber er tut es nicht als Antwort auf die in Christus erkannte und anerkannte Liebe Gottes.“ Zur Unterscheidung der Geister sei eine Rückführung auf die christlichen Grundlagen daher ein notwendiger Schritt. Vielleicht habe Emil Wachter mit seiner Behauptung recht, die zeitgenössische Kunst engagierter Christen werde aus dem Grund nicht in Museen und Ausstellungen gezeigt, weil es aus einem Grund stammt, aus dem man sich gelöst zu haben glaubt: nämlich der Bibel.“
Der zeitgenössische autonome Mensch stecke in der Krise der Selbstfindung, da er sich nicht als Geschöpf begreifen wolle, und doch, „um es salopp zu sagen, sich auch nicht als Self-made-man erklären kann“, betonte Bischof Hofmann. Religion und Kunst seien keine nebeneinander stehenden oder sich bedrängenden Blöcke, sondern fußten vielmehr in einer Wurzel. Für die Kunst sei daher auch das Mittel der bewussten Verneinung des Wahren, Guten und Schönen legitim, sofern es nicht zu Verherrlichung des Diabolischen pervertiere.
(2107/0776; E-Mail voraus)